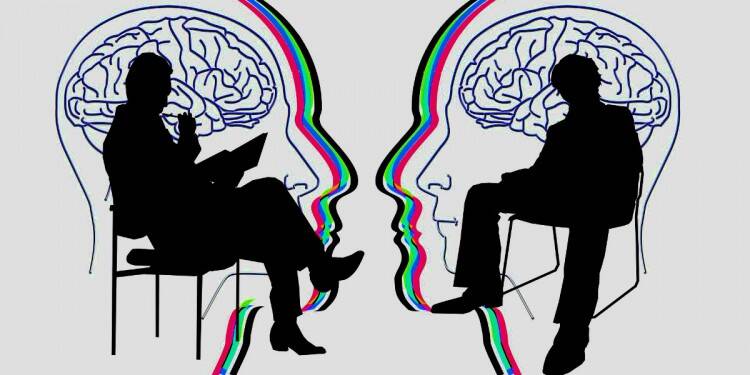
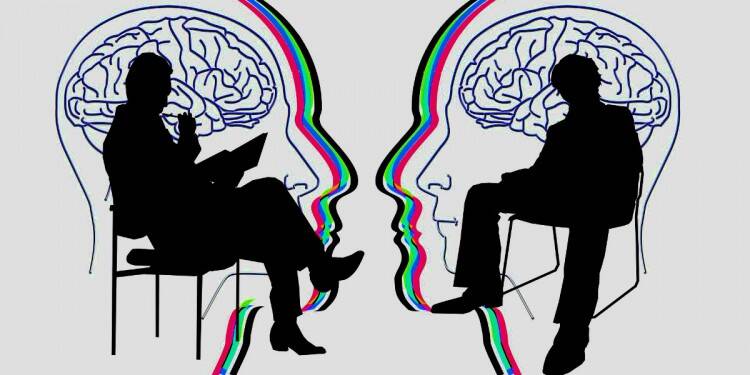
In meinem Beruf geht es unter anderem um die Begutachtung von Straftätern. Dabei spielen die Begriffe Schuldfähigkeit beziehungsweise Schuldunfähigkeit eine zentrale Rolle. Wie Schuldunfähigkeit definiert ist und diagnostiziert wird, möchte ich hier nun etwas genauer erläutern.
Die Definition der Schuldunfähigkeit
Schuldunfähigkeit wird nach den Paragrafen 20 und 21 des Strafgesetzbuches definiert. Vier Eingangsmerkmale sind dort formuliert: die krankhafte seelische Störung, die tiefgreifende Bewusstseinsstörung, der Schwachsinn sowie die schwere andere seelische Abartigkeit. Es ist die Aufgabe des Gutachters, zu prüfen, ob eine dieser Voraussetzungen zur Tatzeit vorlag. Ist dem nicht so, erübrigt sich die Frage nach der Schuldunfähigkeit bereits.
Trifft mindestens eine dieser Voraussetzungen zu, wird geprüft, ob der Proband aufgrund dessen nicht einsichtsfähig war. Das bedeutet, dass die Einsichtsfähigkeit des Probanden zur Tatzeit aufgrund der Krankheit oder Störung außer Kraft gesetzt war. Bestand die grundsätzliche Fähigkeit zur Einsicht, erfolgt eine Prüfung dahingehend, ob seine Krankheit erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Verhaltenssteuerung hat. Nur, wenn diese Voraussetzungen vorliegen, kann der Proband als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig angesehen werden. Entscheidend ist weiterhin, dass die psychische Erkrankung nicht nur in der Tat zutage trat, sondern auch tatunabhängig bestand.
Die Diagnose – eine Kombination aus Vorgeschichte und Verhaltensbeobachtungen
Die Diagnose stützt sich zum einen auf die Vorgeschichte und zum anderen auf die Verhaltensbeobachtung des Probanden. In den meisten Fällen findet dafür eine ambulante Untersuchung in der psychiatrischen Praxis statt. Ich als Psychiater beobachte die Verhaltensweisen des Probanden genau. Los geht das schon bei der Begrüßung: Ist der Proband pünktlich? Weiß er, wo er gerade ist? Wie gestaltet sich die zwischenmenschliche Interaktion? Wie bewegt er sich? Was drücken Mimik und Gestik aus? Diese Beobachtungen kombiniere ich mit den Erkenntnissen aus Akteninformationen und gegebenenfalls Vorberichten aus anderen Kliniken. Meist lässt sich daraus bereits eine psychiatrische Diagnose ableiten. Liegen darüber hinaus körperliche Erkrankungen vor, werden zusätzliche Untersuchungen vorgenommen. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Untersuchung des Kopfes im MRT oder eine Laboruntersuchung handeln.
Die eigentliche Tat wird selten thematisiert
Interessant ist, dass in diesen Gesprächen oft überhaupt nicht über die eigentliche Tat gesprochen wird. Bei genauerer Betrachtung ist dies nur logisch, schließlich ist es meine Aufgabe als Psychiater, eine tatunabhängige Erkrankungzu diagnostizieren. Die bereits genannten Eingangskriterien müssen tatunabhängig vorliegen und weite Bereiche des Lebens betreffen. Anschließend prüfe ich, ob eine Verbindung zwischen Krankheit und Tat besteht. Hinzukommt, dass sich die Probanden selbst häufig nicht zur Tat äußern möchten, da dies bei der Beweiserhebung, während der Gerichtsverhandlung, zu Problemen führen könnte.
Eine gewisse Skepsis ist immer angebracht
Natürlich unterstelle ich keinem Probanden, dass er mich von Anfang an belügt. Dennoch ist eine gewisse Skepsis angebracht. Wer sich in einem Strafverfahren befindet, nimmt es mit der Wahrheit schon mal nicht so genau, um einen für ihn möglichst positiven Ausgang zu forcieren. Da ein wesentlicher Teil der Diagnose auf meinen Beobachtungen basiert, ist es glücklicherweise nicht von so großer Bedeutung, ob jemand mir gegenüber die Unwahrheit behauptet oder nicht. Aufgrund meiner jahreslangen Erfahrung, welche ich mit psychisch kranken Menschen gesammelt habe, weiß ich, wie sich bestimmte psychische Erkrankungen äußern. Ein Proband muss also schon über ein großes schauspielerisches Talent verfügen, um mir so etwas vorzuspielen.
Bildquelle: © geralt_pixabay_CC0


5 Kommentare Kommentieren