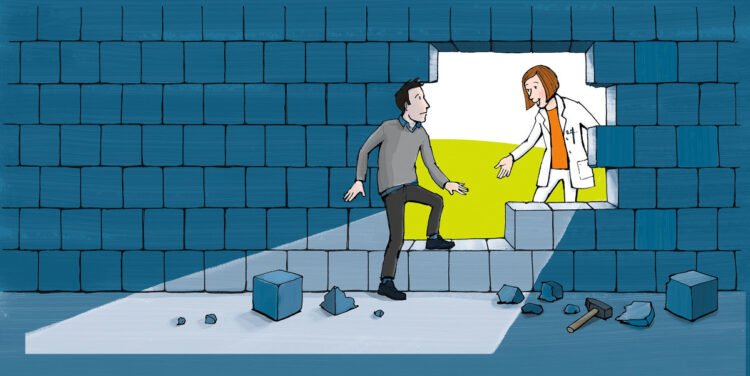
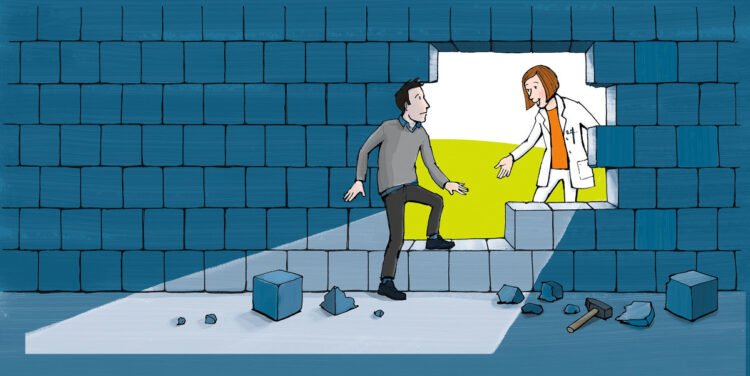
Heidi Höhn, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Forums Schmiede e. V., im Gespräch mit Reinhard Belling, Vorsitzender der Vitos Konzerngeschäftsführung
Wer sich in einer Selbsthilfeinitiativen engagiert und/oder selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, hat in vielen Teilen eine andere Perspektive auf dieses Thema als wir sie als Organisation normalerweise haben und, in Teilen, auch haben müssen. Reinhard Belling ist der Überzeugung, mehr Offenheit für die Sichtweise der Betroffenen würde uns guttun. Deshalb spricht er in diesem Interview mit Heidi Höhn, die sich mit ihrer Selbsthilfeinitiative seit über 30 Jahren für die Entstigmatisierung psychisch kranker Menschen einsetzt.
Was brauchen Betroffene wirklich, und wie kann ihrer Meinung nach die Entstigmatisierung psychiatrischer Erkrankungen gelingen?
Reinhard Belling: Frau Höhn, Sie sind Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Forums Schmiede e. V.. Sie setzen sich in Taunusstein seit vielen Jahren für die Entstigmatisierung psychisch kranker Menschen ein. Wir haben uns vor einer Anhörung im Hessischen Landtag kennengelernt. Dort haben Sie mich mit Ihrer Aussage beeindruckt: „Ich habe zwölf Diagnosen. Und es geht mir gut.“
Ihre Haltung ist in vielerlei Hinsicht eine andere als unsere aus Kliniksicht. Für uns steht der Krankheitsbehandlungsbedarf vielfach im Vordergrund. Wir möchten Krankheiten heilen. Sie vermitteln eher den Eindruck, dass es darum geht, mit den Erkrankungen möglichst gut zu leben. Das ist ein Auftrag, den wir als Leistungserbringer im Bereich der Eingliederungshilfe haben. Mich interessiert es, von Ihnen zu erfahren, wie Sie diesen Satz konkret meinen, was Ihre Haltung dazu ist. Und was Sie in der Folge von uns als Klinikträger erwarten.
Was sind die Dinge, die Ihnen wichtig sind, um mit Ihren Diagnosen zu leben?

Heidi Höhn, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Forums Schmiede e. V.
Heidi Höhn: Mir geht es gut, weil die Menschen mich von klein auf so angenommen haben, wie ich bin. Ich kann mir meine Verrücktheit leisten, weil ich von Anfang an die günstigsten Voraussetzungen in meinem Umfeld hatte. Ich bin in eine Zeit hineingeboren, in der alle verrückt waren. 1940 war buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen. Als Kind habe ich versucht, mich in dieser Welt zurechtzufinden. Ich war die Mittlere von fünf Schwestern.
Ich bin fasziniert davon, wie unterschiedlich jede und jeder von uns ist. Deshalb ist Ihre Frage so wichtig, Herr Belling. Denn wir alle sind das Umfeld von Menschen, die krank werden über ihre Eigenheiten.
In all den Jahren wurden mir ganz unterschiedliche Diagnosen gestellt. Unter anderem galt ich als schwer erziehbar, später kamen Borderline, ADS, Profilneurose und weitere hinzu. Weil ich so ein positives Umfeld habe, war ich nie stationär in der Psychiatrie. Man könnte meiner Meinung nach viele Klinikeinweisungen vermeiden, wenn die Menschen verstehen würden, was psychische Erkrankungen sind und wie sie entstehen.
Reinhard Belling: Frau Höhn, bei Vitos gibt es seit einigen Jahren die sogenannte stationsäquivalente Behandlung, kurz StäB. Ein Team aus ärztlichem Personal, Pflegekräften, Mitarbeitenden aus Psychotherapie, Ergo- und Sozialtherapie kommt zu den Patient/-innen nach Hause. Behandelt wird auch an Wochenenden und Feiertagen.
Das Angebot wird unserer Erfahrung nach sehr gut angenommen. Dreiviertel unserer Patienten sind Frauen. Sie übernehmen in vielen Fällen Zuhause die Care Arbeit. Ohne StäB würden sie tagsüber oftmals nicht in Therapie gehen können, geschweige denn sich mehrere Wochen stationär in eine Klinik behandeln lassen.
Was denken Sie über das Konzept der aufsuchenden Behandlung?
Heidi Höhn: Für Menschen, die in geregelten Verhältnissen leben, kann StäB sicher eine gute Alternative zu einem stationären Aufenthalt oder einer Behandlung in einer Tagesklinik sein. Ich habe in meinem Umfeld unversorgte Menschen. Eine Frau zum Beispiel hat nicht mal Strom in ihrer Wohnung. Wenn man sie darauf anspricht und ihr Hilfe anbieten will, rastet sie völlig aus. Vermutlich empfindet sie das als übergriffig. Sie möchte ganz sicher nicht, dass Behandler zu ihr in die Wohnung kommen und sich in ihre Angelegenheiten einmischen. Meiner Ansicht nach muss man die Menschen einfach so nehmen, wie sie sind. Dort, wo sie Unterstützung brauchen und möchten, kann man sie unterstützen, aber man darf sie nicht bevormunden. Sie merken mit der Zeit schon selbst, wenn sie sich in etwas verrannt haben. Das Gute in jedem von uns kommt immer wieder zum Vorschein, das bleibt.
Reinhard Belling: Ja, da haben wir andere Ausgangspunkte. In akuten Krisen ist es eine große Hilfe für unsere Patientinnen und Patienten, dass Fachleute sie in ihrem eigenen Zuhause aufsuchen. Sie sind dankbar und lassen guten Gewissens Menschen in ihr Wohnumfeld. Gleichwohl kann ich es nachvollziehen, dass manche Menschen das als Eindringen empfinden.

Reinhard Belling, Vitos Konzerngeschäftsführer
Heidi Höhn: Wenn jemand in ordentlichen und geregelten Verhältnissen lebt, mag die Hemmschwelle, fremde Menschen in die eignen vier Wände zu lassen, geringer sein.
Menschen, die psychisch erkranken, sind in unserer Gesellschaft nach wie vor stigmatisiert. Die Dunstglocke der Geheimnistuerei ist tödlich für diese Menschen. Die glauben ja wirklich, sie wären nicht normal und hätten keine Lebensberechtigung. Was kann man tun? Man kann einfach mal so tun, als wäre eine psychische Erkrankung etwas völlig Normales.
Reinhard Belling: Frau Höhn, sehen Sie denn, dass es in den letzten Jahrzehnten, seit der Psychiatrie-Enquete, Fortschritte gegeben hat?
Heidi Höhn: Ich habe mich schon immer für Psychiatrie interessiert. Und dann stand damals im Stern ein Artikel zur Enquete und wie sich jetzt alles ändern wird. Dann kam die UN-Konvention. Selbsthilfe müsse einbezogen werden, hieß es. Aber bei der Anhörung, bei der wir uns kennengelernt haben, kamen die Belange der Selbsthilfeinitiativen ganz zum Schluss, als hätten wir gar nichts zu sagen. Nach wie vor werden zum Beispiel unsere sehr guten Ansätze hier in Taunusstein für eine offene Anlaufstelle nicht finanziert. Unter Fortschritt stelle ich mir etwas Anderes vor.
Reinhard Belling: Was kann man tun, um die Psychiatrie zu entstigmatisieren?
Heidi Höhn: Ich würde empfehlen, Kontakt zu Selbsthilfegruppen aufzubauen und über die Gruppen Zugang zu den Menschen zu suchen. Man muss die Sozialarbeiter aus ihren Büros rausholen. Man sollte viel mehr Cafés in Eckläden eröffnen, um Anlaufstellen zu schaffen und Öffentlichkeit herzustellen.
20 Jahre lang habe ich den historischen Lehenshof geleitet. Das war ein sagenhaftes Projekt. Dort konnte sich jeder mit seinen individuellen Stärken einbringen. Der eine war fit in Elektrotechnik und hat sich eine kleine Werkstatt eingerichtet. Ein anderer hatten Freude am Fotografieren und konnte sich dort ein Fotolabor aufbauen. Zeitweise hatten wir eine Trommelgruppe, ein Nacht-Café und ein Flohmarktlädchen. Bis zuletzt gab es die Bücherstube. Die war ein Highlight. Die Frau, die sie eingerichtet hat, kannte sich bestens aus und hatte eine große Leidenschaft für Literatur, mit der sie auch andere anstecken konnte. Das alles waren Orte der Begegnung.
Die Scheune und die dazugehörigen Stallungen waren schwierig zu bewirtschaften, aber uns ist immer wieder etwas eingefallen. Wir waren eine tolle Truppe und sind sogar gemeinsam in den Urlaub gefahren. Das war eine unvergesslich schöne Zeit. Letztendlich mussten wir den Lehenshof aufgaben, weil das Ministerium unseren Finanzierungsantrag abgelehnt hat. Aktuell haben wir nur noch einen Treffpunkt in einer Wohnanlage in der Jägerstraße. Dort macht ein Mann, der viele Jahre auf der Straße gelebt hat, heute mit großer Begeisterung ein Sonntags-Café.
Es fehlt ganz einfach finanzielle Unterstützung der Selbsthilfebewegung. Ohne einen eigenen Treffpunkt ist es sehr schwer, die Gruppen, die aus unserer Zeit im Lehenshof hervorgegangen sind, am Laufen zu halten. In Taunusstein habe ich einen kleinen Eckladen entdeckt. In den großen Schaufenstern könnten Kunsthandwerker aus unserer Zeit im Lehenshof ihre Exponate ausstellen und gemeinsam mit Mitgliedern unserer Gruppe mit Kaffee und Kuchen einen niedrigschwelligen Ort der täglichen Begegnung schaffen. Einen Ort, an dem wir unsere eignen Ideen umsetzen können. Alles Organisatorische können und möchten wir gern selbst übernehmen. Doch das alles scheitert bisher an den 1.500 Euro monatlicher Mietkosten.
Reinhard Belling: Das Bundesteilhabegesetz hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Teilhabe auch von chronisch psychisch kranken Menschen verbessert wird. Was denken Sie darüber?
Heidi Höhn: Damit Teilhabe wirklich gelingen kann, gibt es aus meiner Sicht an vielen Stellen noch großen Nachholbedarf. Ein positives Beispiel ist für mich ein professioneller Treffpunkt in Wiesbaden, eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (kurz PsKB) in der Scharnhorststraße. Da können die Leute kommen, wann sie wollen. Es werden Ausflüge angeboten. Jeder und jede kann mitmachen, wenn er oder sie will. Es wird auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen. Sie werden nach ihren Wünschen gefragt. So muss es sein. Da habe ich zum ersten Mal das Gefühl, es verändert sich etwas. In vielen tagesstrukturierenden Maßnahmen wird den Menschen zu viel vorgegeben und sie werden viel zu wenig einbezogen. Das ist keine Teilhabe, das ist Bevormundung.
Reinhard Belling: Das Thema Notfall und Krisendienst war ebenfalls ein wichtiges bei der Anhörung im Landtag bei der wir uns getroffen haben. Da gibt es bisher noch keine guten Strukturen in Hessen. Halten Sie das für ein wichtiges Thema?
Heidi Höhn: Ja, natürlich ist das ein wichtiges Thema! Wenn man Zahnschmerzen hat, kann man sich jederzeit an einen Notdienst wenden, auch am Wochenende, mitten in der Nacht oder an Feiertagen. Wenn eine psychische Krise plötzlich akut wird, was macht man dann? Da ist ja niemand erreichbar. Meine Idee ist es, in Zusammenarbeit mit den Selbsthilfeinitiativen flächendeckend kleine Anlaufstellen zu schaffen, in denen jeweils auch ein Sozialarbeiter und gegebenenfalls auch ein Jurist angebunden ist. Das wäre meiner Ansicht nach die Lösung vieler Probleme, auch derer des Krisendienstes. Was nützt denn ein Krisendienst, wenn derjenige, an den sich die Betroffenen wenden, diese überhaupt nicht kennt? Man braucht einen Draht zu den Menschen, um ihnen in Notsituationen helfen zu können. Man braucht ihr Vertrauen, um in Ausnahmesituationen deeskalieren zu können. Es muss eine gute Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfeinitiativen und Profis geben.
Es gibt nichts, was man nicht verstehen könnte. Wir Betroffenen brauchen Unterstützung, die unsere Unzulänglichkeiten auffängt, und wir brauchen offene Treffpunkte. Und vor allem, muss man die Menschen so sein lassen, wie sie sind. Man kann Menschen nicht zu Gesundheit erziehen. Ich werde mich weiterhin für Menschen einsetzen, die ein kleines bisschen anders sind als die anderen. Denn, was ist schon normal?
Reinhard Belling: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen Frau Höhn. Das war für mich ein sehr beeindruckendes Gespräch, und ich werde einiges davon mitnehmen.
Info: Hier finden Sie weiterführende Informationen zur Selbsthilfegruppe Forum Schmiede e. V. : www.forum-schmiede.de


0 Kommentare Kommentieren